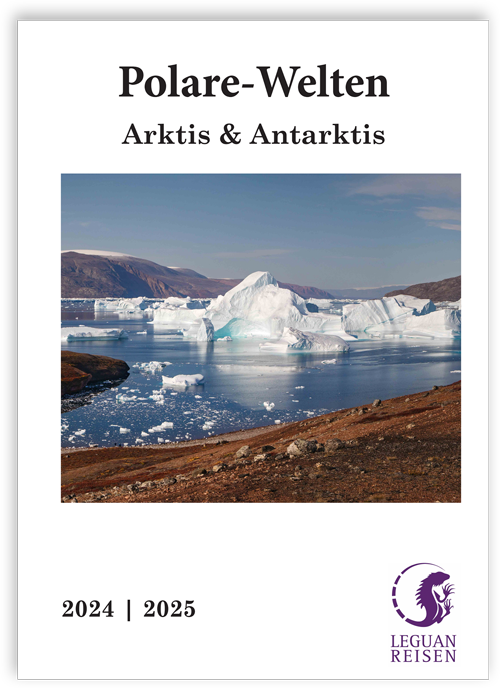Wer meint, nahe der Äquatorlinie nicht auch frieren zu können, der täuscht sich gewaltig. In der nördlichen Sierra Ecuadors wird es in den Höhenlagen nachts eisekalt. Selbst in Ibarra, der Andenprovinzstadt auf gut 2.200 M.ü.M., ist nichts zu spüren von der tropischen Lage. Von hier aus führt ein etwa 200 Kilometer langes Schienengleis runter an den Pazifik – Verbindung von den Hochland-Indigenen zur afroecuadorianischen Bevölkerung.
„…der Wecker klingelte wohl, doch wir beide haben ihn überhört. Nun wird es höchste Zeit, auf den Kaffee muss eben verzichtet werden. Nur raus aus den Kissen, rein in die Klamotten, Wasser ins Gesicht, alles gut verstauen – los geht’s mit kleinem Rucksack und Vespertüte in Richtung Bahnhof. Was da vor fünf Uhr schon oder noch abgeht in den Straßen: Menschen, die irgendwo in einer Ecke frierend schlafen; die Kirche ist bei geöffneter Türe hell erleuchtet; Betrunkene torkeln durch die Dämmerung; an Straßenständen brutzeln Frauen Fleischstückchen, feurige Soßen oder sonst was. Ganz normale Geschäfte und Kneipen sind teilweise offen, Leute sitzen schon bei Cola und Bier.
Natürlich ist auch am Bahnhof viel los: Afroecuadorianer – auch Kinder, die sich dort gestern Abend mit Decken oder Säcken zum Schlafen gelegt haben, räkeln sich nun am frühen Morgen; ‚billetes‘ für den ‚Sechs-Uhr-Autocarrilo‘ werden gekauft; Körbe, Säcke, Taschen, Kisten warten mit ihren Besitzern aufs Gefährt; alte Bettlerinnen erhoffen sich ein paar Cent von den wartenden Menschen – es ist arschkalt.
Wir kaufen ‚billetes‘ für nicht mal zwei Euro pro Person, essen ein Frühstücksbrötchen, staunen und warten frierend. Etwas vor sechs Uhr kommen dann die vier ‚Autocarrilos‘ angequietscht. Umgehend sind alle vollbesetzt, mit sämtlichem Gerümpel beladen und selbst im Mittelgang stapelt sich schon Gepäck. Es ist schon hell, als sich das seltsame Gefährt in Bewegung setzt, und so klar, dass wir im Hintergrund Ibarras einen majestätischen schneegekrönten Vulkanberg sehen können.
Die Fahrt führt fast ständig abwärts und das ‚Ding‘ bekommt manchmal einen ganz schönen Zacken drauf. Erst rattern wir in vielen Kurven die kahle Landschaft runter, überqueren auf schmalsten Brücken gewaltige Schluchten und folgen später dem im Tal liegenden reißenden Fluss. Die ausgetrockneten braunen Berge werden von einer Vegetation aus Buschwerk, Kakteen und später von immer höheren, grüneren Pflanzen abgelöst. Irgendwann sind Zuckerrohr, Tomaten und Kartoffeln angepflanzt und die kleinen Dörfer – bestehend aus Steinhütten und Staubwegen – nehmen zu. Fast ausschließlich Afroecuadorianer leben an der gesamten Strecke, auch die überwiegende Mehrheit der ‚Autocarril-Mitfahrer‘ sind Afroecuadorianer. Bei einem etwa zehnminütigen Stopp geht’s abartig im und ums Gefährt zu: draußen kochen korpulente Muttis in dampfenden Töpfen auf offenem Feuer, bieten Mädchen und Buben schreiend Getränke, Obst und ‚desayuno‘ (Frühstück) an. Sie halten die Tütchen, Teller und Flaschen ans Fenster hoch. Einige stürmen sogar das vollbesetzte Schienenfahrzeug mit ihrer Ware, klettern mit nackten, schmutzigen Füßen über Kisten und Armlehnen durch den vollgestopften ‚Carrilo‘ und versuchen sich in der Lautstärke des Anpreisens gegenseitig zu übertreffen. Die Insassen verschlingen zum Frühstück einen Teller mit Reise, Bohnen, Nudeln, Salat und Fleisch, trinken noch schnell eine Cola – morgens vor acht Uhr. Nein – nichts für uns.
Als der opulente Fahrer lachend und doch würdevoll seinen Platz einnimmt und kräftig mit der Hupe zur Weiterfahrt ruft, werden schnell noch die letzten Happen verschluckt, die letzten Obstkäufe gemacht. Der Schienenbus wird wieder voll, mit Schwanken und Quietschen setzten wir die Fahrt fort. Rufen, Winken, dann beherrscht wieder die durch alte Lautsprecher schlingernde Salsa Musik die Atmosphäre.
Weiter geht es talabwärts. Wir bemerken, dass die Kupplung des ‚Autocarrils‘ total im Eimer ist. Na, ja, macht ja nichts, wir fahren schließlich noch. Es wird langsam grüner und wärmer, mehr und mehr Bananenstauden bestimmen das Bild. Mit der Hitze nehmen auch die Gerüche zu und bis wir dann ganz vom Dschungel aufgenommen sind, ist deren Intensität so stark, als wolle einer den anderen überduften: Schweiß, Urin, der Geruch nach Zitrusfrüchten – eben alles, was so ausdünstet. Teilweise ist unsere Fahrschneise gerade so breit, dass wir durchpassen, die Pflanzen klatschen oft an die Fenster, bunte unbekannte Insekten mitbringend, die uns den Körper auszusaugen versuchen,
Immer wieder regnet es eine Weile, was die wunderschönen Grünpflanzen und Tropenblumen glänzend macht im Licht. Der Bus tuckert an schon längst vergessenen, halbverfallenen, von Schlingpflanzen überwachsenen Pfahlbauten vorbei. Wir fühlen uns, als wären wir in Afrika. In einer undurchdringlich erscheinenden Dschungellandschaft tauchen plötzlich ein paar Holzhütten auf – Papa, Mama und unzählige ‚ninos‘ sitzen auf der Veranda oder strecken beim Hupen des einfahrenden ‚Carrilos‘ die Köpfe aus den Fenstern. Leute, die lachen, die winken, die barfuß gehen, zerfetzte Kleidung tragen und schmutzig sind. Drumherum Hühner, Hunde, Schweine – sonst nichts außer Urwald. Für uns ein unvorstellbares Leben, irgendwie so naturverbunden und doch auch so arm, einfach, dreckig.
Im ‚Autocarril‘ wird es zunehmend stickiger, der Kartenkontrolleur kämpft sich immer mal wieder durch das Gewühl von Menschenhaut und Gepäckstücken. Er klettert aufs Dach, das inzwischen längst ebenfalls voll ist – keiner soll hier schwarzfahren. In den Dörfern verkaufen die Muttis und Kinder jetzt neben Obst auch ‚pan de coco‘ – Kokosbrot. Getränke werden in Plastiktütchen geleert und mitgenommen.
Am Nachmittag muss das Schienenfahrzeug plötzlich stoppen: der Wagen vor uns ist an einer Weiche mit den Rädern aus den Schienen gehüpft und ratterte etliche Meter über die Holzschwellen. Das sieht böse aus! In glühender Hitze versuchen viele Männer mit Wagenhebern und Pflöcken den Karren wieder aufs Gleis zu heben – harte Knochenarbeit ist angesagt. Unter heißer Sonne sitzen oder stehen die wartenden Reisenden, werden dabei bald von Kindern aus dem nahen Dorf mit ‚pan de coco‘ versorgt. Solche ‚Breakdowns‘ kommen wohl nicht selten vor. Nach einer Stunde und etlichen Fehlversuchen steht der Schienenbus wieder in der Spur. Unter lautem Hupen und Winken der Zurückbleibenden geht’s weiter. Der Fahrtwind tut gut.
Mit Salsa Musik an Bord schlingern wir nach knapp zehnstündigem Rattern quietschend und hupend in San Lorenzo ein. Endstation! Puh – ein anstrengendes Unternehmen, ein kleines Abenteuer, eine tolle lohnenswerte Fahrt ist vorüber.“
Während der Coronapandemie wurden leider alle Gleisverbindungen in Ecuador zumindest vorerst eingestellt. Bleibt zu hoffen, dass zumindest einzelne Strecken wie die um die berühmte „Teufelsnase“ im Süden wieder aufgenommen werden. Es sind übrigens nicht alle Schienenfahrten so abenteuerlich, man kann es auch gemütlicher haben… 😉
Bis nächsten Freitag
Martina Ehrlich